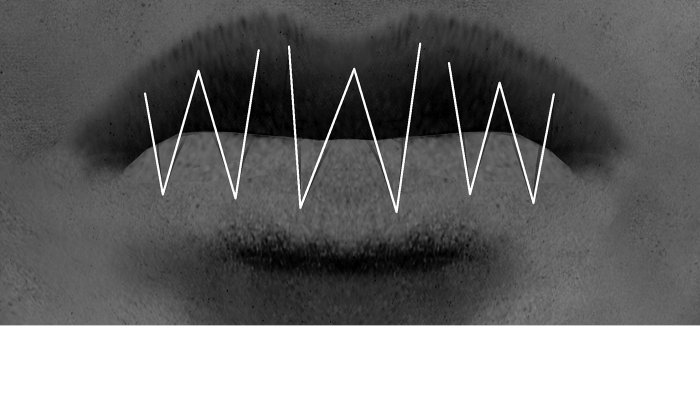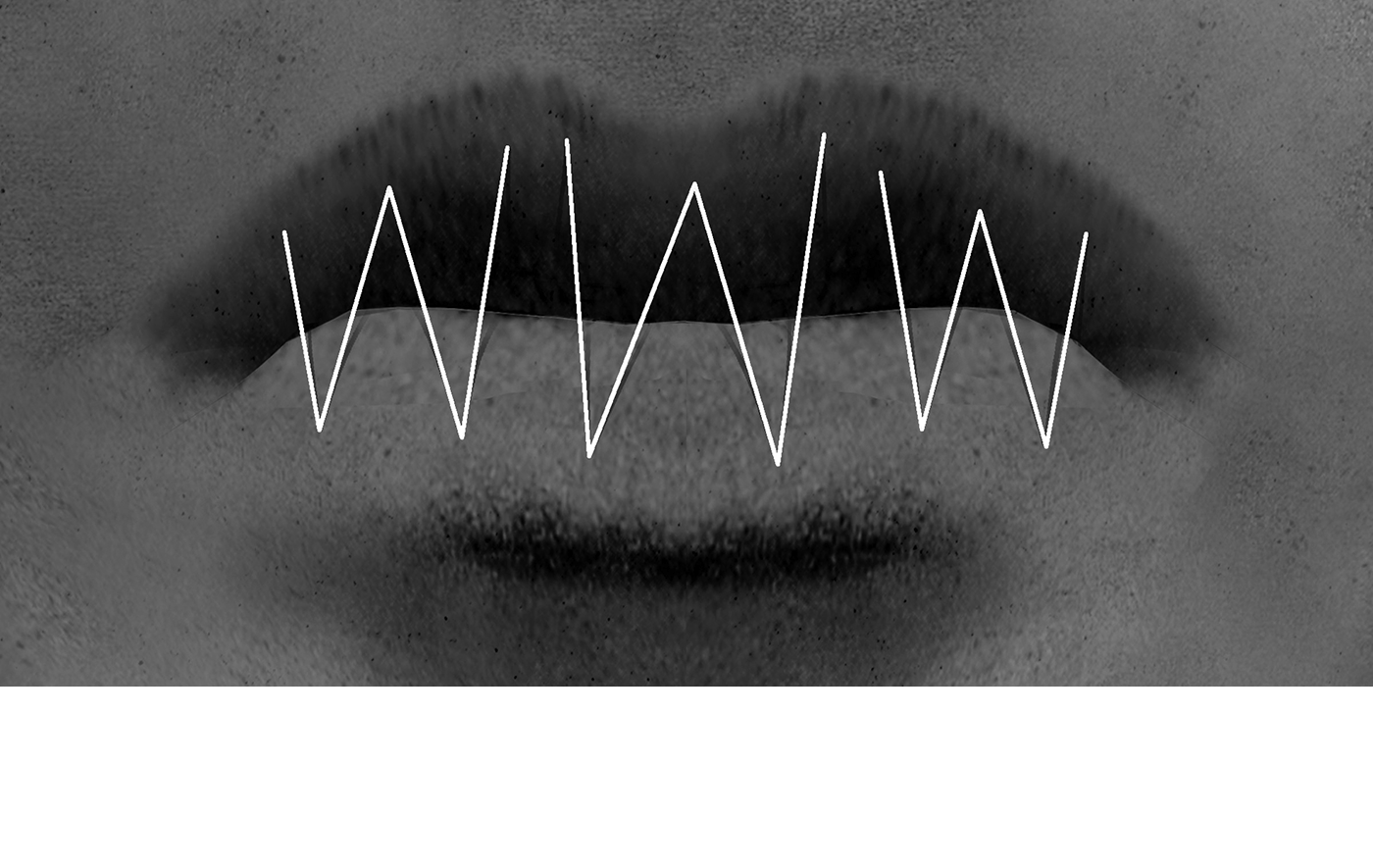Der Schutz der Meinungsfreiheit und der Privatsphäre im Internet befindet sich an einem kritischen Punkt. Staaten weigern sich, Prinzipien, die sie auf internationaler Ebene akzeptieren, auf ihre eigene, nationale Gesetzgebung und Praxis anzuwenden. Das ist, als würden alle Wegweiser zur Meinungsfreiheit in die eine Richtung zeigen, während Regierungen hartnäckig darauf bestehen, die falsche Abzweigung zu nehmen, und gegenüber ihren erschrockenen Passagiere beteuern, das geschehe zu ihrer eigenen Sicherheit.
Unterschiede zwischen dem, was Staaten bei den Vereinten Nationen unterstützen und was sie zuhause tun, sind nichts neues, wobei es ihnen im Fall von Menschenrechten im Internet offensichtlich nicht einmal auffällt. Sie scheinen den vagen Eindruck zu haben, dass das Internet irgendwie anders ist, vielleicht mächtiger als ältere Medien, und deshalb wollen sie es reflexhaft stärker einschränken.
Sie haben Recht damit, dass das Internet Individuen nie dagewesene Möglichkeiten gibt, um grenzüberschreitende Gemeinschaften zu schaffen und auf globale Informationen zuzugreifen. Aber das rechtfertigt nicht notwendigerweise, die Privatsphäre und die Redefreiheit nie dagewesenen polizeilichen Befugnissen zu opfern.
Technologische Innovationen bestärken Menschen - im guten und im gefährlichen Sinne - und verkleinern die Welt seit vielen Jahrzehnten. Gleichzeitig erlebten die internationalen Menschenrechtsstandards eine Blütezeit. Schreibmaschinen mögen vom Aussterben bedroht sein, aber Menschenrechte scheinen heute wichtiger zu sein als je zuvor. Und wie Regierungen sie im digitalen Zeitalter schützen, dies wird darüber entscheiden, ob das Internet eine befreiende oder eine einengende Kraft entfaltet.
Was Staaten sagen und was sie tun
Die Schere zwischen bestehenden Normen und dem, was Staaten wirklich tun, ist in der aktuellen Debatte über Überwachung besonders deutlich erkennbar.
Edward Snowden, ein ehemaliger Angestellter der US-Regierung, verschaffte dieser Debatte im Jahr 2013 gewaltigen Schwung. Er spielte Dokumente an die Medien, die belegten, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten massiv und willkürlich Daten über Menschen in den USA und im Ausland sammelten, die keinerlei Verbindungen zu irgendwelchen Vergehen hatten. Auf die Enthüllungen reagierten Gesellschaften und Regierungen empört. Die UN wurde aktiv, die Generalversammlung diskutierte das Thema und verabschiedete Resolutionen, ebenso der Menschenrechtsrat. Expertenberichte wurden veröffentlicht und sogar eine neue Expertenposition für das Recht auf Privatsphäre geschaffen. Überall auf der Welt klagten Menschen gegen Überwachungsmaßnahmen und Gesetzgeber diskutierten über sie.
Trotzdem verkleinerten nur wenige Länder in den folgenden Jahren ihre Überwachungsapparate. Stattdessen zementierten viele Regierungen Befugnisse gesetzlich, die denen sehr ähnlich sind, die in den USA aufgedeckt wurden.
In den USA gewannen einige Reformen an Dynamik, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass sie das atemberaubende Ausmaß der Datensammlung und Echtzeit-Überwachung deutlich eindämmen können. Der Kongress ersetzte das Gesetz, auf dessen Grundlage Millionen Anrufdaten gesammelt wurden, durch ein neues, das etwas zurückhaltender war. Präsident Barack Obama entschuldigte sich für die Ausspähung anderer Regierungschefs. Aber die Rechtsbehörden, die hinter der Überwachung von Übersee-Kommunikation stehen, erlauben noch immer, „geheimdienstlich relevanter Daten über Ausländer“ zu sammeln. Diese vage Formulierung kann leicht dazu dienen, umfangreich Daten abzufangen, auch von US-Bürgern, die versehentlich ins Visier geraten.
Großbritannien verabschiedete die Investigative Powers Bill, ein besorgniserregendes Gesetz, das Massenüberwachung durch direktes Anzapfen von Unterwasser-Internetkabeln legalisiert sowie Hacking-Angriffe der Regierung und thematische Vollziehungsbefehle, die es den Geheimdiensten ermöglichen, ohne richterliche Zustimmung großflächige Ziele zu definieren.
Auch Frankreich begann im Jahr 2015, Überwachungsmaßnahmen auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, allerdings mit hochproblematischen Gesetzen, die kurz nach den Anschlägen im Schnelldurchlauf verabschiedet wurden. Als der UN-Menschenrechtsausschuss überprüfte, inwieweit Frankreich den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte einhält, kam er zu dem Schluss, dass das Geheimdienstgesetz vom Juni 2015 übermäßig viel Macht für außerordentlich weitreichende Überwachung verleihe, um breite und schlecht definierte Ziele zu erreichen, und ohne einen angemessenen und unabhängigen Aufsichtsmechanismus. Kürzlich urteilte der Staatsrat, dass die durch das Gesetz legalisierte Überwachung von drahtloser Kommunikation ohne richterlichen Beschluss verfassungswidrig ist.
Russland schlug ebenfalls einen rückwärtsgewandten Weg ein. Seit den Gesetzesänderungen aus dem Jahr 2016 müssen Unternehmen Kommunikationsinhalte sechs Monate lang speichern, Kommunikationsdaten drei Jahre lang, und diese Daten auf russischem Territorium aufbewahren. Darüber hinaus müssen Unternehmen „zur Entschlüsselung [digitaler Kommunikation] notwendige Informationen“ herausgeben, eine Vorschrift, der eine Hintertür zu verschlüsselten Daten schafft.
China steht bei der Zensur von Meinungsäußerungen im Internet seit langem an vorderster Front und kontrolliert den Zugang zum Netz durch eine nationale Firewall. Im Jahr 2016 verabschiedete die Regierung ein Gesetz über die Internetsicherheit, nach dem Unternehmen dazu verpflichtet sind, zu zensieren und die Anonymität im Internet einzuschränken. Auch müssen sie Nutzerdaten in China speichern und undefinierte „Zwischenfälle im Bereich der Netzwerksicherheit“ überwachen und melden. All das verstärkt die Angst, dass die Überwachung noch zunimmt.
Sogar Brasilien und Mexiko, beides Kritiker der Massenüberwachung der Nationalen Sicherheitsbehörde der USA (NSA) und engagierte Befürworter der Privatsphäre bei den Vereinten Nationen, diskutierten im Jahr 2016 über Gesetze zu Internet-Verbrechen, die die Vorratsspeicherung ausgeweitet und den Zugang zu Informationen sowie die Redefreiheit eingeschränkt hätten. Deutschland, einer der weltweit wichtigsten Datenschutzbefürworter, bestätigte im Oktober 2016 ein Gesetz, das massenhafte, willkürliche Überwachung von Nicht-Staatsbürgern ermöglicht, was dem Land die Kritik von drei verschiedenen UN-Menschenrechtsexperten sowie eine Klage vor dem Verfassungsgericht einbrachte.
Kein Wunder, dass der UN-Experte für Meinungsfreiheit beklagte: „Einer der enttäuschendsten Aspekte der aktuellen Situation… ist, dass viele Staaten mit einer langen Tradition des Einsatzes für die Meinungsfreiheit - in ihren Gesetzen und in ihren Gesellschaften - Maßnahmen in Betracht ziehen, die Menschenrechtsverletzungen Tür und Tor öffnen.“
Drei Aspekte, die das Internet einzigartig machen (und wie uns das Angst einjagt)
Der widersprüchliche Zustand, in dem Staaten erst beteuern, dass sie auch im Internet die Menschenrechte wahren wollen, und dann Gesetze erlassen, die sie einschränken, reflektiert eine tiefer liegende Unstimmigkeit in der Wahrnehmung des Internets, seinen Versprechen und seinen Gefahren.
Vor einiger Zeit wurde noch voll utopischer Hoffnung über das Internet und die Menschenrechte diskutiert - das Netz würde die Meinungsfreiheit voll verwirklichen, Zensur ausschalten, soziale Mobilisierung in unbekanntem Ausmaß ermöglichen. Bis zu einem gewissen Grad sind diese Versprechen wahr geworden. Aktivisten in autokratischen Staaten, die Versammlungen, Protest und unabhängige Medien unterdrücken, können ihren Anliegen online Aufmerksamkeit verschaffen. Wissen, das zuvor in Bibliotheken, Universitäten und anderen Netzwerken der Elite verwahrt wurde, ist nun für Nutzer in entlegenen Dörfern, Regionen und Slums zugänglich. Am neuen Ort „Cyberspace“ werden Gedanken ausgetauscht und globale Erfindungen mit globalen Auswirkungen für viele Menschen greifbar.
Es dauerte allerdings nicht lange, bis Behörden zurückschlugen, die diese Entwicklungen als bedrohlich wahrnahmen. Dissidenten und Kritiker restriktiver Regierungen, die versuchten im Internet der Unterdrückung zu entgehen, werden überwacht, öffentlich bloßgestellt und verhaftet. Dieser Trend ist heute besonders stark in der Türkei, Ägypten, Vietnam, Saudi Arabien, China und Tschetschenien. Einige Regierungen, etwa die ägyptische, bestraften manche im Internet getätigte „Vergehen“ sogar härter, als wenn sie offline verübt werden.
Sobald Aktivisten (und Kriminelle) versuchten, sich durch Anonymität oder Verschlüsselung zu schützen, erließen Regierungen Anordnungen oder schlugen Gesetze vor, um Technologieunternehmen dazu zu zwingen, ihre Nutzerdaten herauszugeben und die Inhalte von Online-Kommunikation zu entschlüsseln. Repressive Regierungen nutzen nationale Firewalls, blockieren soziale Medien oder schalten das Internet vollständig ab, um Online-Aktivitäten zu kontrollieren.
Und auch in nicht-autoritären Umfeldern trifft das Mobilisierungspotential des Internets auf widersprüchliche Gefühle. Manche Leute bewundern zwar, wie gut sich demokratische Aktivisten online organisieren können, sind aber besorgt, dass der Islamische Staat aus der Ferne Anhänger rekrutiert. Zwar applaudieren sie denjenigen, die Beweise für Kriegsverbrechen öffentlich machen, aber sie verurteilen „Trolle“, die ihre Opfer bloßstellen, bedrohen oder quälen.
Um herauszufinden, was hinter dieser zunehmenden Ambivalenz gegenüber Meinungsäußerungen im Internet steckt, ist es hilfreich, sich damit zu befassen, inwiefern sie sich von der Offline-Kommunikation unterscheiden. Mindestens drei Aspekte zeichnen das Internet aus: Rede im Internet kann enthemmter - also, weniger hemmend - sein als Rede in der „wirklichen“ Welt; sie bleibt bestehen und über lange Zeiträume hinweg zugänglich, sofern sie nicht bewusst entfernt wird; und sie ist von ihrer Natur her grenzüberschreitend, sowohl in ihrer Verbreitung als auch in ihrer Verfügbarkeit. Jeder dieser Aspekte macht Rede im Internet mächtig. Und jeder verkompliziert die Aufgabe, sie zu regulieren.
Die Enthemmtheit der Online-Rede ist ein vielfach untersuchtes, aber sehr schlecht verstandenes Phänomen. Sie erklärt die große Reaktionsfreudigkeit und das „Teilen“ bei unseren Interaktionen in sozialen Medien, und auch die größere Ungezwungenheit, Unhöflichkeit und Beschimpfungen. Enthemmtheit wird häufig mit Anonymität in Verbindung gebracht, aber sie prägt auch die Online-Rede von identifizierbaren Nutzern. Viele Studien verweisen auf zahlreiche Faktoren, die zu diesem Phänomen beitragen, etwa die Geschwindigkeit und die Unpersönlichkeit des Internets, in dem nichtverbale Zeichen und Interaktion fehlen. Tatsächlich verschlimmert sich das Verhalten teilweise, wenn Nutzer identifizierbar (also für andere Teilnehmer als schlimmste „Trolle“ auf der Seite erkennbar) sind. Das deutet darauf hin, dass es nicht notwendigerweise der Königsweg zu besserem Verhalten ist, Nutzer nur unter ihrem Klarnamen veröffentlichen zu lassen. Allerdings sind solche Vorschriften besonders bei autokratischen Regierungen beliebt, die Dissidenten identifizieren wollen, um sie zum Schweigen zu bringen.
Die Langlebigkeit von Online-Informationen fördert alle Arten der Recherche und der Informationsgewinnung, lange nachdem erste Berichte veröffentlicht wurden. Bei politischen Debatten Fakten in Echtzeit nachprüfen zu können, kann zum Beispiel massiv zu informierten Wahlentscheidungen beitragen. Aber böswillige oder falsche Rede lebt auch lange. Auch wenn es einer von ihr betroffenen Person gelingt, sie in einem Rechtsgebiet entfernen zu lassen, bleibt sie unter Umständen in einem anderen verfügbar oder wird dort gespiegelt.
Der Europäische Gerichtshof befasste sich im Jahr 2014 in seinem Costeja-Urteil mit diesem Problem. Er betonte, dass Suchmaschinen wie Google dazu verpflichtet seien, Daten auszuschließen, die „unzutreffend, unangemessen, irrelevant oder exzessiv“ sind - ein Grundsatz, nach dem der öffentliche Zugriff auf Informationen deutlich stärker eingeschränkt werden könnte, als es internationale Menschenrechtsstandards oder manche nationale Verfassungen erlauben. Eine europäische Entscheidung darüber, was „irrelevante“ oder „exzessive“ Informationen sind, könnte zum Beispiel von einem US-amerikanischen Gericht als Verletzung der im ersten Verfassungszusatz garantierten Meinungsfreiheit ausgelegt werden. Die fragliche Information wäre dann in den USA immer noch verfügbar, auch wenn sie in Europa von Suchergebnissen ausgenommenen wäre.
Die Langlebigkeit von Informationen im Internet und ihre weltweite Zugänglichkeit hat Gerichte in Kanada und Frankreich dazu veranlasst, Google aufzufordern, Inhalte weltweit aus seinem Verzeichnissen zu löschen, also nicht nur in den Regionen, für die die Gerichte zuständig sind. Aber wenn sich Kanada und Frankreich damit durchsetzen, ist zu erwarten, dass Verfügungen, Inhalte oder Links zu Inhalten weltweit zu entfernen, zur Norm werden, auch Verfügungen aus Ländern, die regelmäßig gegen Dissidenten vorgehen. Sollten Staaten, die die Menschenrechte stärker respektieren, solchen Anordnungen folgen?
Vielleicht kommen wir nicht einmal dazu, diese Frage zu stellen. Bei solchen Verfügungen müsste der Sprecher Widerspruch einlegen, nicht die Partei, die seine Rede unterdrücken will. Personen, die kontroverses Material im Internet veröffentlichen, haben unter Umständen nicht die Möglichkeit, Löschverfügungen in allen Ländern zu widersprechen. Globale Löschverfügungen sind mächtig, weil sie das Internet einfrieren können. Möglicherweise könnten sie die Masse an Inhalten reduzieren, die einige Länder als rechtswidrig einstufen, aber genauso gut könnten sie das Internet um viel Kunst, Heterodoxie, Kritik und Diskussion berauben.
Schließlich ermächtigt die grenzüberschreitende Zugänglichkeit und Verbreitung von Online-Kommunikation diejenigen, die weit entfernt von den sozialen und kommerziellen Zentren leben, an denen sich Informationen konzentrieren, ganz gleich, ob sie Dorfbewohner oder Rebellen im Hinterland sind. Regierungen versuchen, Daten zu kontrollieren, indem sie vorschreiben, dass diese innerhalb ihrer Grenzen aufbewahrt werden, was die Überwachung erleichtert, oder indem sie Firewalls nutzen, um unliebsame Inhalte von ihrer Bevölkerung fernzuhalten. Das mag ansprechend erscheinen, wenn dadurch der Einfluss von Terroristen begrenzt, der Diebstahl geistigen Eigentums verhindert oder denjenigen, die ihre Opfer beschämen und bloßstellen, keine Bühne geboten werden soll. Aber solche Maßnahmen werden sofort weniger attraktiv, wenn man sie aus der Perspektive von oppositionellen Autoren und Aktivisten betrachtet, die ihre Gedanken über die Firewall werfen und darauf hoffen, dass sie dort weiterleben und anderswo zugänglich werden.
Zusammengenommen ermöglichen diese Eigenschaften - produktives, oft unbeaufsichtigtes Teilen; Zugänglichkeit über lange Zeiträume und Grenzen hinweg - nicht nur neuartige wissenschaftliche, künstlerische oder auch kriminelle Zusammenarbeit, sondern beunruhigenderweise auch umfangreiche soziale Profile zu erstellen und Menschen zu verfolgen. Datenerfassung, -sammlung und Vorratsspeicherung stehen zunehmend im Zentrum menschenrechtlicher Debatten, weil sie neue und gravierende Freiheitsgefährdungen darstellen. Dazu bemerkte der bekannte Internet-Archivar Brewster Kahle: „Edward Snowden hat uns gezeigt, dass wir mit dem Internet versehentlich das weltgrößte Überwachungsnetzwerk geschaffen haben.“
Den neuen Problemen, die mit den besonderen Merkmalen der Online-Rede einhergehen, sollten wir begegnen, indem wir die Privatsphäre und die Meinungsfreiheit noch stärker schützen als zuvor, nicht indem wir beides aufgeben. Das Internet ist kein außergewöhnliches und bedrohliches Medium, sondern zunehmend das normale Mittel, um alle möglichen Arten von Rede und Informationen in unserer Welt zu verbreiten. Es ist kein Ausnahmezustand. Der Ausgangspunkt der Menschenrechte ist, dass die vollständige Einhaltung von Rechten wie der Meinungsfreiheit und der Privatsphäre die Norm ist; ihre Einschränkung muss die Ausnahme bleiben.
Auch bei neuen Technologien bleiben Menschenrechtsstandards gültig
Im Jahr 1948 hatten die Verfasser eines der Gründungsdokumente der UN, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die Weitsicht, eines der grundlegenden Rechte vor seiner Überalterung zu schützen. Artikel 19 schreibt fest:
Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. (Hervorhebung durch die Autorin)
Seitdem haben sowohl der UN-Menschenrechtsrat als auch die Generalversammlung immer wieder betont, dass alle Rechte online wie offline gelten. Zwar bringen neue Medien auch neue Herausforderungen mit sich, aber die Vorstellung findet kaum Unterstützung, dass der Aufstieg des Internets Menschenrechte weniger wichtig gemacht habe oder dass das Internet ganz anderen Prinzipien unterworfen sei.
Die Grundprinzipien dafür, wie zu bestimmen ist, ob Einschränkungen der Meinungsfreiheit, des Zugangs zu Informationen, Vereinigungen oder der Privatsphäre mit internationalen Menschenrechtsstandards vereinbar sind, sind längst etabliert und spiegeln sich in vielen regionalen und nationalen Rechtssystemen wieder. Der Menschenrechtsausschuss, das UN-Expertengremium, das den Internationalen Park über bürgerliche und politische Rechte auslegt, fasste die Grundsätze im Jahr 2004 folgendermaßen zusammen:
Staaten müssen nachweisen, dass [die Einschränkung] notwendig ist, und nur solche Maßnahmen ergreifen, die zur Erreichung eines legitimen Zieles geeignet und verhältnismäßig sind. So wird gewährleistet, dass die im Pakt verbrieften Rechte kontinuierlich und wirksam geschützt werden. Keinesfalls dürfen die Einschränkungen in einer Weise angewandt oder darf sich in einer Weise auf sie berufen werden, die die Essenz eines im Pakt verbrieften Rechts beeinträchtigt.
Beachtenswert ist, dass die „Notwendigkeit“ zur Erreichung eines „legitimen Ziels“ geprüft werden muss, eines Ziels also, das im dem Pakt definiert ist, zum Beispiel die nationale Sicherheit, die öffentliche Ordnung oder die Rechte Dritter. Der Staat trägt die Verantwortung, zu beweisen, dass „ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang“ zwischen dem einzuschränkenden Recht und der Bedrohung besteht. Es wäre zum Beispiel nicht ausreichend, persönliche Informationen nur deswegen zu sammeln, weil sie möglicherweise zu einem undefinierten Zeitpunkt in der Zukunft einer Reihe von nationalen Interessen zuträglich sein könnten.
Über die geläufigsten Begründungen für Überwachung sagte der Sonderberichterstatter, dass „Staaten die nationale Sicherheit und die öffentliche Ordnung häufig als bloße Worthülsen nutzen, um unterschiedlichste Einschränkungen zu rechtfertigen“. Die nationale Sicherheit und die öffentliche Ordnung werden menschenrechtlich als Interessen der Öffentlichkeit verstanden, nicht als Partikularinteressen einer bestimmten Regierung oder Elite. „Nationale Sicherheit“ ist das öffentliche Interesse daran, die nationale Unabhängigkeit oder territoriale Integrität zu wahren, nicht das Interesse eines Individuums oder einer Gruppe daran, an der Macht zu bleiben oder einen Vorteil gegenüber Konkurrenten zu wahren. Unfaire Diskriminierung ist niemals im Interesse der Öffentlichkeit und kann nicht die Grundlage einer legitimen Einschränkung von Rechten darstellen. Entsprechend können Überwachungsmaßnahmen, die sich gegen religiöse, ethnische oder nationale Gruppen richten, nicht als „notwendig“ für die „öffentliche Sicherheit“ legitimiert werden.
Das großflächige Sammeln und langfristige Speichern von Massen irrelevanter persönlicher Daten ist selten „notwendig“, also unmittelbar verbunden mit einer spezifischen Bedrohung der nationalen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung. Wie oben erwähnt erfordern internationale Menschenrechtsstandards, dass Gesetze, die die Redefreiheit einschränken, „verhältnismäßig“ und notwendig sind, und es ist noch schwerer, nachzuweisen, dass groß angelegte Überwachungsmaßnahmen beide Anforderungen erfüllen.
Um verhältnismäßig zu sein, muss die Einschränkung eines Rechts die am wenigsten eingreifende Maßnahme sein, um das öffentliche Interesse zu schützen, das dem Eingriff zugrunde liegt. Es ist schwer vorstellbar, dass ein regelmäßiger Eingriff in die Privatsphäre aller und die Überwachung der Kommunikation aller in einem angemessenen Verhältnis zu einer bestimmten Bedrohung stehen könnten, auch nicht zu der Bedrohung, die von einer bestimmten terroristischen Gruppe ausgeht. Stattdessen drohen solche Maßnahmen, die Essenz des Rechts auf Privatsphäre zu beeinträchtigen.
Die besonderen Eigenschaften des Internets können alte Probleme - sei es Terrorismus, bedrohliche Rede, Diskriminierung von Minderheiten oder die Prävention von Verbrechen - drängender erscheinen lassen und den Eindruck erwecken, es seien neue Lösungen notwendig. Aber wenn wir glauben, dass die Menschenrechte Bedeutung haben, ist unsere Verpflichtung noch immer, jede Entscheidung, die Rechte einschränkt, rigoros darauf zu prüfen, ob sie notwendig und verhältnismäßig ist.
Die Standards auf heutige Herausforderungen anwenden
Vertreter von Strafverfolgungsbehörden argumentieren, dass es notwendig sei, einen großen „Heuhaufen“ an Daten zusammenzutragen und zu durchsuchen, um Terroristen zu identifizieren und Anschläge zu verhindern. Das beruht auf der Annahme, dass mehr gesammelte Daten mehr relevante Daten produzieren, die nur identifiziert werden müssen, dass also mehr „Nadeln“ gefunden werden können, von denen eine echte Bedrohung ausgeht. Das mag bei Problemen funktionieren, die massenhaft auftreten und bei denen die Risikofaktoren leicht zu identifizieren sind.
Aber Terroristen und Anschlagspläne sind relativ selten und unterscheiden sich stark in ihren Profilen, ihrer Motivation und anderen Details. Eher besteht die Gefahr, dass falsche Hinweise das System überfordern und Ressourcen davon abziehen, produktivere Maßnahmen zu entwickeln, etwa verlässliche Informantennetzwerke oder die Suche nach Hinweisen in der kriminellen Vergangenheit eines Verdächtigen.
Wie der Sicherheitsexperte Bruce Schneider in seinem aktuellen Buch „Data und Goliath“ sagte, besteht „kein bestimmter Grund für die Annahme, dass irrelevante Daten über unschuldige Menschen es erleichtern, einen Anschlagsplan zu entdecken, und es gibt sehr viele Beweise dafür, dass sie es nicht tun“. Sogar die NSA hat ihr Personal aufgefordert, „weniger falsche Daten zu speichern“. Je mehr irrelevante Daten auf dem „Heuhaufen“ landen, desto schwerer ist es, das Erfassungsprogramm als verhältnismäßig zu legitimieren. Und wenn das massenhafte Sammeln auch zur massenhaften Vorratsdatenspeicherung führt, kommen noch mehr Fragen auf. Eine ist, ob Daten, die zu einem Zweck gesammelt wurden (etwa geheimdienstlich relevante Daten über Ausländer), später auch zu einem anderen Zweck verwendet werden können (etwa Durchsetzung von Drogengesetzen).
Sofern nicht jedes Mal unabhängig geprüft wird, ob eine Wiederverwendung der Daten notwendig und verhältnismäßig ist, ist nicht gewährleistet, dass sie internationalen Menschenrechtsstandards entspricht. Und Daten einfach deshalb aufzubewahren, weil sie in der Zukunft möglicherweise genutzt werden könnten, kann kaum als „notwendig“ bezeichnet werden. Wie das oberste Gericht von Norwegen vor kurzem in einem Fall, bei dem es um die Beschlagnahmung von Dokumentarfilmmaterial ging, feststellte, ist die bloße Möglichkeit, dass dieses Material „wertvolle Hinweise“ enthielt, die die Rekrutierung von Terroristen verhindern könnte, nicht ausreichend, um ihre Veröffentlichung „notwendig“ zu machen.
Ein anderes Problem stellt die Verwendung von verzerrten Daten für prognostische Zwecke dar. Unternehmen sammeln und analysieren seit langer Zeit Daten über Konsumenten, um vorhersagen zu können, welche Werbung, Nachrichten oder Stellenanzeigen zu ihren Profilen passen könnten. Datenschutzgesetze können ein Stück weit vor diesem „Profiling“ schützen, indem sie transparenter machen, was Unternehmen mit den Nutzerdaten tun, und Nutzern ermöglichen, Daten zu korrigieren oder abzulehnen, überhaupt Daten zur Verfügung zu stellen.
Aber wenn Regierungen Daten analysieren, um vorherzusagen, wo die Polizei eingesetzt werden sollte oder ob ein Angeklagter mit einem bestimmten Profil ein Wiederholungstäter werden könnte, ist oftmals wenig nachvollziehbar, welche Daten dem Algorithmus zugrunde liegen - und verzerrte Daten produzieren verzerrte Ergebnisse. Praktiken von Strafverfolgungsbehörden reflektieren nur zu oft Vorurteile, wie Human Rights Watch mit Blick auf polizeiliche Profilerstellung und deren Auswirkungen auf Migranten und Muslime und ethnische Unterschiede bei der Verhaftung und Verurteilung in den USA, menschenrechtswidrige Personenkontrollen von Muslimen in Frankreich oder polizeiliche Diskriminierung von Transgender-Personen in Sri Lanka aufgezeigt hat. Algorithmen, die auf verzerrten Daten basieren, können vorurteilsbehaftete Profile und Praktiken in einer endlosen Spirale bestätigen und noch stärker verzerren.
Überwachung schränkt immer Rechte ein, auch dann, wenn sie gerechtfertigt ist. Vorurteile und verzerrte Daten können daraus Diskriminierung oder sogar Verfolgung machen. Wenn der Glaube, die ethnische Zugehörigkeit, die sexuelle Orientierung oder die „Rasse“ einer Person zu Indikatoren für ihre potenzielle Kriminalität gemacht werden - von der Polizei oder einem Algorithmus - dann werden ihre Rechte verletzt. Programme, mit denen „gewaltsamer Extremismus bekämpft“ werden soll, können in diese Falle tappen, wenn sie sich genauso sehr auf den Ausdruck „extremistischer“ Überzeugungen oder Meinungen konzentrieren wie auf alle anderen Indikatoren für tatsächliche Gewalt.
Beispielsweise definiert die britische „Präventions“strategie ihr Ziel als Bekämpfung von „Ideologien“ - also Ideen - und definiert „Extremismus“ als „verbale oder aktive Opposition zu grundlegenden britischen Werten“. Schulen, und mit ihnen Lehrer, sind verpflichtet, die Internetaktivitäten von Kindern auf Anzeichen von Radikalisierung hin zu überwachen, und einzugreifen, wenn sie feststellen, dass ein Kind dafür „empfänglich“ ist. Das Programm wurde umfassend von Lehrern kritisiert, weil es die Meinungsfreiheit im Klassenzimmer einschränkt. Viele merkten auch an, dass es genau die Gemeinschaften stigmatisiert und ausgrenzt, auf deren Unterstützung die Strafverfolgungsbehörden besonders angewiesen sind, wenn sie Bedrohungen identifizieren wollen.
Wenn auch hier das Prinzip der Verhältnismäßigkeit angewandt wird, erkennt man, dass ein Programm, das die Rechte vieler Menschen einschränkt, kaum das am wenigsten restriktive Mittel zum Schutz der Sicherheit ist. Vielmehr können andauernde Eingriffe in Rechte die nationale Sicherheit und die öffentliche Ordnung gefährden, indem sie das Vertrauen in die Regierung und den Schutz von Minderheiten beschädigen. In diesem Zusammenhang sind auch Gesetze wie das russische relevant, die die Anonymität unterminieren, oder Gesetze wie das chinesische, die Unternehmen dazu verpflichten, Verschlüsselung zu dekodieren. Zweifellos verschlüsseln einige Kriminelle ihre Daten, um nicht entdeckt zu werden. Aber gewöhnliche Bürger verschlüsseln ebenfalls, um Verfolgung zu vermeiden, Transaktionen zu sichern oder einfach ihre Privatsphäre bei normaler Kommunikation und bei normalen Anliegen zu schützen.
Es gibt weder ein absolutes Recht auf Anonymität noch auf Verschlüsselung. Ein Gericht kann im Rahmen einer Ermittlung anordnen, dass die Identität eines Verdächtigen offengelegt wird, oder eine Person dazu auffordern, ihre Kommunikation zu entschlüsseln. Aber es ist mit großer Wahrscheinlichkeit unverhältnismäßig, wenn eine Regierung behauptet, es sei notwendig, in die Rechte und die Sicherheit von Millionen Menschen einzugreifen, um eine Bande böser Jungs zu fangen, und Unternehmen zwingt, „Hintertüren“ in Sicherheitstechnologien einzubauen.
Als das US-amerikanische Justizministerium versuchte, Apple dazu zu zwingen, seine Sicherheitstechnik umzustellen, um auf das iPhone des Schützen von San Bernadino zugreifen zu können, ging es um weit mehr als um die Sicherheit dieses einen Telefons. Die „Hintertür“ hätte an Kriminelle gespielt oder von ihnen gehackt werden können, um durch sie andere Telefone dieses Modells angreifen zu können. Auch gab es keinerlei Garantie dafür, dass die US-Regierung oder andere Regierungen die „Hintertür“ nicht wiederholt angefragt oder genutzt hätten, was die Sicherheit aller anderen Nutzer dieses Modells unterminiert hätte.
Regierungen können ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen nicht ausweichen, indem sie Unternehmen damit beauftragen, unhöfliche Rede zu unterdrücken, Informationen zu löschen oder unnötige Daten vorzuhalten. Solche Unternehmensmaßnahmen können sich auf die Rechte genauso unverhältnismäßig auswirken, wie wenn die Regierung sie selbst eingeschränkt hätte. Private Unternehmen können die Regeln für ihre Dienstleistungen noch dazu flexibel definieren, und diese Regeln können Nutzer weitaus schwerer anfechten als Gesetze.
Bevor sie die Anbieter von Internetdiensten dazu drängen, alle eingehenden Daten zu überwachen oder zu speichern oder Hintertüren in Sicherheitstechnik einzubauen, sollten Regierungen die menschenrechtlichen Auswirkungen solcher Maßnahmen bedenken. Auch gesellschaftliche Gruppen, die Unternehmen dazu auffordern, Werte wie Höflichkeit aufrecht zu erhalten, sollten berücksichtigen, ob die geforderten Regeln transparent und nachvollziehbar wären, angefochten werden könnten oder von einem blinden Algorithmus umgesetzt werden, der den Unterschied zwischen Pornographie und Fotojournalismus nicht erkennen kann.
Staatliche Praktiken mit internationalen Standards in Einklang bringen
Dass Rechte nur eingeschränkt werden können, wenn das notwendig und verhältnismäßig ist, bedeutet nicht, dass Regulierung unmöglich ist. Manche Grenzen sind wichtig, weil es auch eine menschenrechtliche Pflicht ist, Menschen vor Terrorismus, Aufrufen zu Gewalt oder Rachepornographie zu schützen. Dieser Grundsatz wird dann ernstgenommen, wenn Gesetze und staatliche Maßnahmen transparent sind, die Exekutive unabhängig beaufsichtig wird und Widerspruch und Schadensersatz möglich sind.
Einschränkungen sollten so wenige Menschen und so wenige Rechte für den kürzesten Zeitraum wie möglich betreffen. Auch ist zu bedenken, ob manche Probleme staatlich gelöst werden müssen oder besser gemeinschaftlich, durch neue Technologie oder dadurch, dass Gegenrede ermöglicht und gefördert wird. Manchmal bedarf es etwas Phantasie, die am wenigsten einschränkende Maßnahme zu finden, sowie Kooperation zwischen den Regierenden und denjenigen, um deren Rechte es geht.
Der gegenwärtige Widerspruch zwischen dem, was Staaten sagen, und dem, was sie tun, kann nicht ewig bestehen bleiben. Entweder werden die Menschenrechte im digitalen Zeitalter leiden oder staatliches Handeln muss wieder den Schutz von Rechten ins Zentrum rücken.
Menschenrechte und Sicherheit sind zwei Seiten derselben Medaille. Wenn Rechte ständig verletzt werden, werden Gesellschaften unsicher. Jeder, der die Zerstörung von Syrien mit ansieht, weiß das. Gesellschaften, die ihren Mitgliedern im Internet ihre Privatsphäre und die Möglichkeit nehmen, sich zu schützen, sind zutiefst verletzlich und empfänglich für Kriminalität, Demagogen, Korruption, Einschüchterung und Stagnation. Auf unserem Weg in die digitale Zukunft ist es nur vernünftig, unsere Rechte mitzunehmen, statt sie zusammen mit unseren Schreibmaschinen am Wegesrand zurückzulassen.